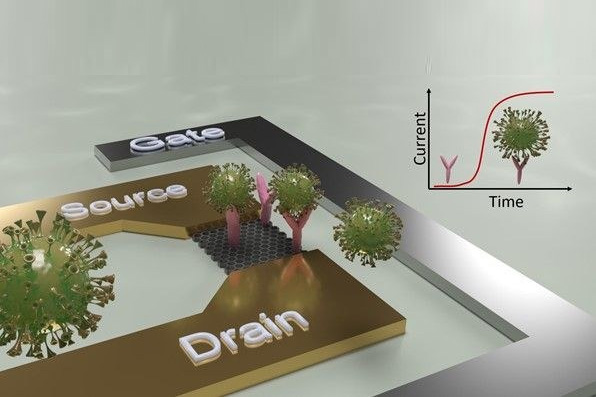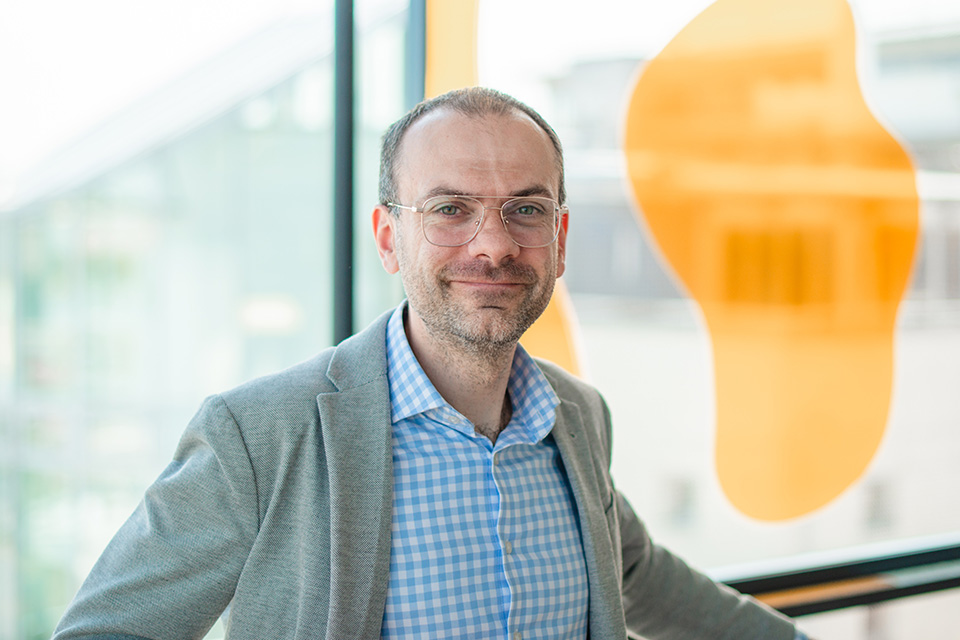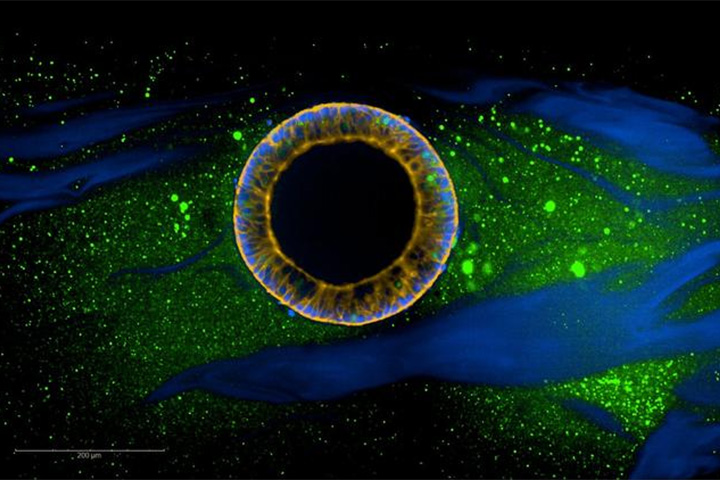Erkenntnisse zur Wasserdiffusion in Polyamid 6
Dr. Anna Katharina Sambale wurde für ihre Doktorarbeit „Beitrag zur Charakterisierung und Berechnung von Feuchtigkeitsverteilungen in Polyamid 6“ mit dem Wilfried-Ensinger-Preis des Wissenschaftlichen Arbeitskreises der Universitäts-Professoren der Kunststofftechnik (WAK) ausgezeichnet. Die Erkenntnisse der Arbeit liefern Grundlagen für eine verbesserte Vorhersage des zeitlich und örtlich veränderlichen Materialverhaltens von PA 6 aufgrund von Veränderungen der umgebenden Luftfeuchtigkeit. Sie sind von wesentlichem Nutzen für die rechnergestützte Auslegung von Bauteilen dieses häufig verwendeten Kunststoffs.
Erkenntnisse zur Wasserdiffusion in Polyamid 6 Read More »