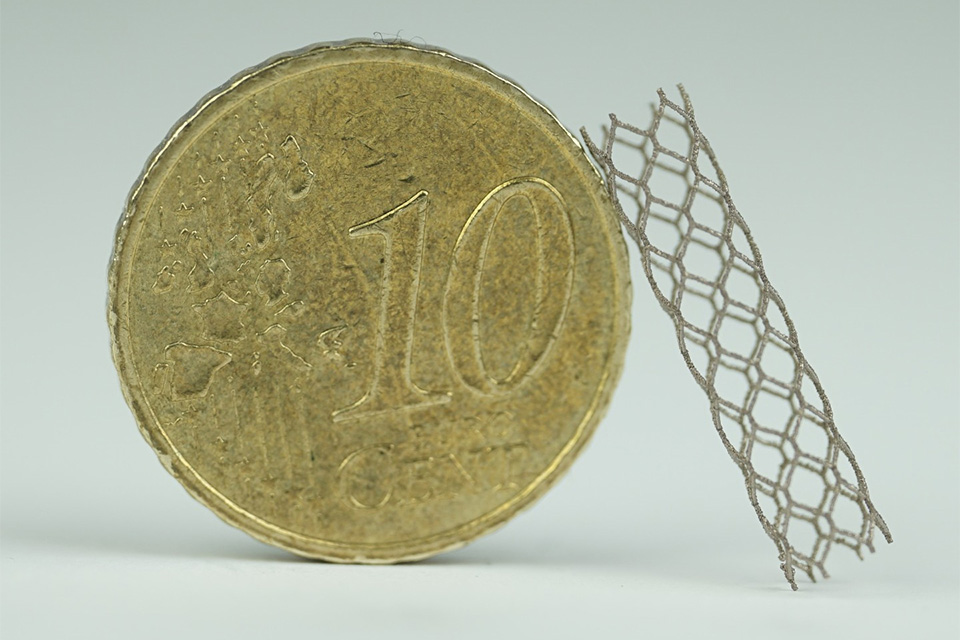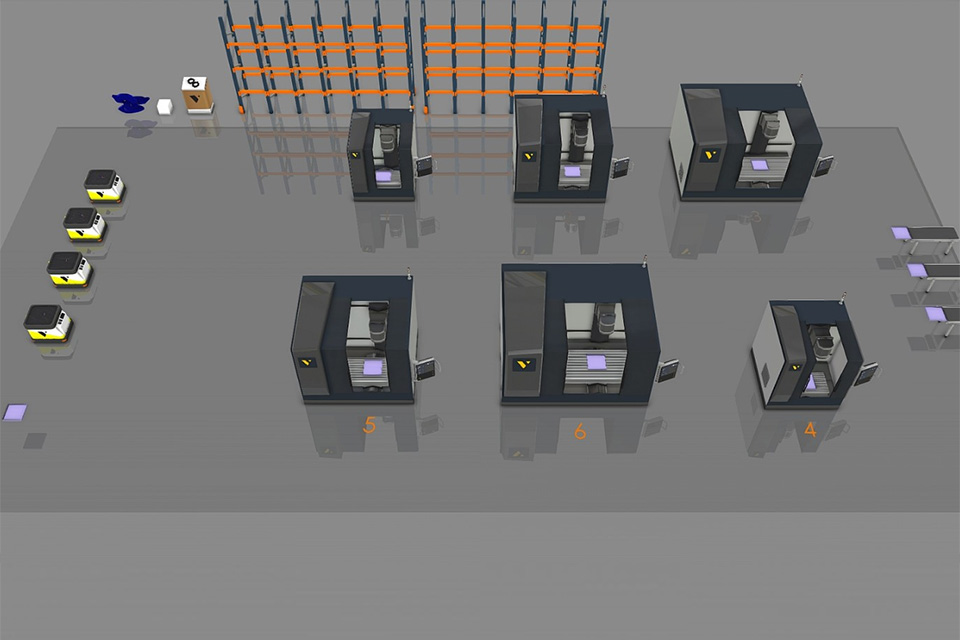Tragende Kunststoffstrukturen aus dem 3D-Drucker
Screw Extention Additive Manufacturing (SEAM) macht’s möglich. Bei Granulat basierten Kunststoffverfahren ist es nun möglich, Produkte hochbelastbar auszulegen und besonders wirtschaftlich herzustellen, auch in geschlossenen Stoffkreisläufen. Das Fraunhofer IWU und die MOSOLF Special Vehicles GmbH demonstrieren mit einem hoch belastbaren 3D-gedrucktes Heckregal und einem Fahrzeugrahmen, dass sich individuelle Formgebung, niedrige Materialkosten und hohe Tragkraft perfekt zu Produkten mit besonderem Nutzwert ergänzen können.
Tragende Kunststoffstrukturen aus dem 3D-Drucker Read More »